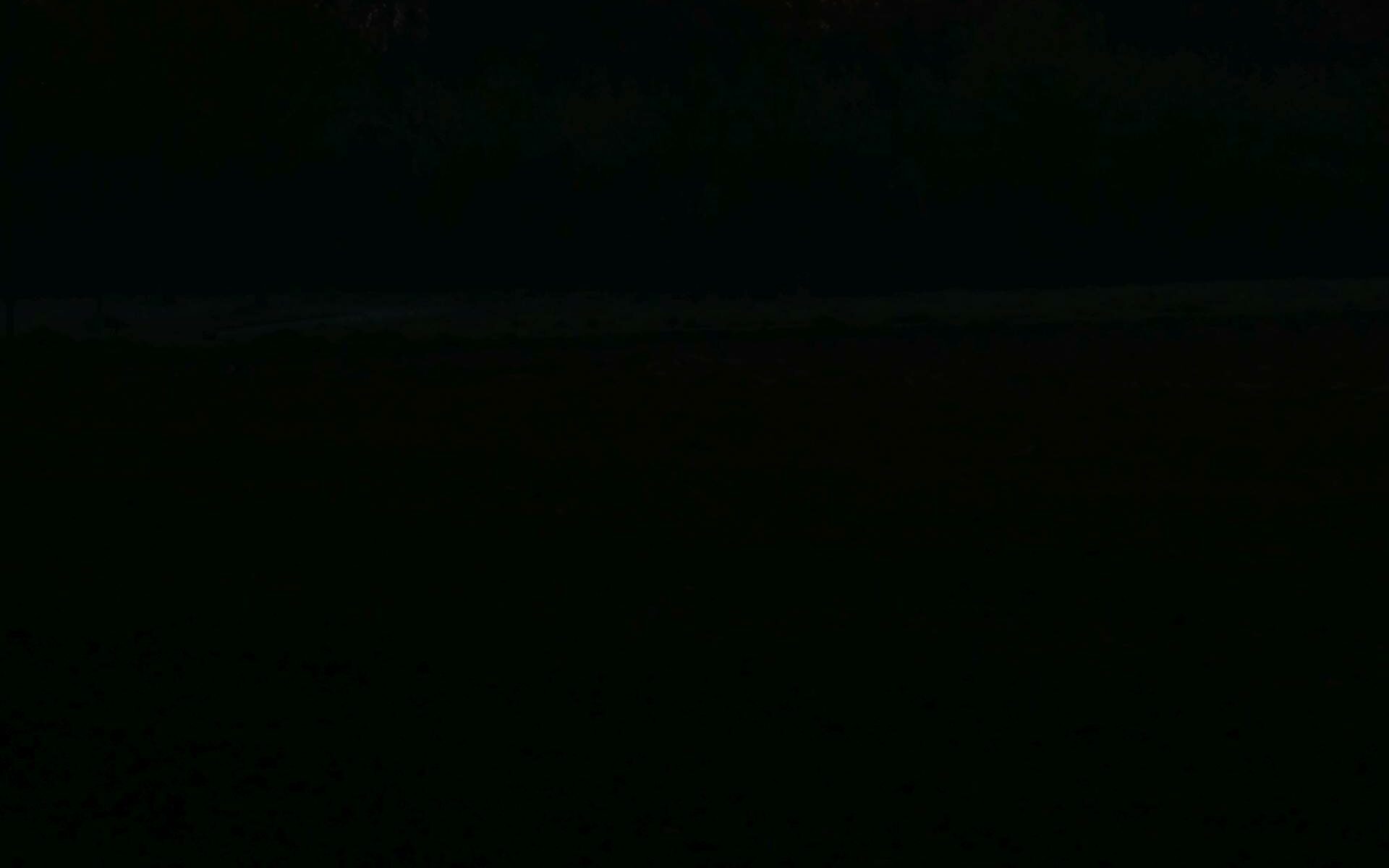Gedanken zur Kontaktreduzierung in Coronazeiten
Überlegungen zur (Trauer-)seelsorge und Beerdigungskultur und darüber hinaus.
Gerade verändern wir alle unseren Umgang mit anderen Menschen.
Und ich frage mich: Trauerseelsorge in Zeiten von Corona – geht das? Wie geht das?
Ein Trauergespräch am Telefon stellt mich vor ganz andere Voraussetzungen als in der realen Begegnung, es ist anstrengender, aber es gibt auch eine Chance: ich muss noch mehr auf Zwischentöne hören, auf das, was ungesagt bleibt, ich merke, dass ich mich deutlich mehr konzentrieren muss auf meine Gesprächspartner. Ich muss auch – bei mehreren Hinterbliebenen – möglicherweise mehrere Telefongespräche führen, die sich vielleicht an der ein- oder anderen Stelle doppeln, die aber den Charme haben, dass man vielleicht freier reden kann über die Oma, wenn die Mutter nicht dabei ist, über den Vater, wenn dessen Lieblingskind (oder aber das schwarze Schaf) nicht neben einem sitzen…
Wie begrüße ich als Beerdigungsdienstleiterin die Menschen vor der Trauerhalle, denen ich sonst die Hand gedrückt hätte, richtig? Es ist anders, aber auch eine Chance – manchmal gibt man den Menschen die Hand und ist doch schon in Gedanken beim nächsten – das geht jetzt nicht. Ich muss den Menschen in die Augen gucken, sie ehrlich anlächeln – so, dass auch meine Augen mitlächeln, falls ich eine Maske trage. Das heißt, ich muss mich dem Menschen, den ich begrüße, deutlich mehr zuwenden…
Generell ist die Frage, wie man zu fremden, aber vielleicht auch zu vertrauteren Menschen einen Kontakt aufnehmen kann, wenn man Abstand halten muss und Maske tragen, der über einen schnellen Gruß.
Ich glaube, wir sind in unserer
schnelllebigen, bunten Welt gar nicht mehr darauf gepolt, uns ganz auf unser
Gegenüber zu konzentrieren, wir sind schnell mal abgelenkt, weil wir gewohnt
sind, dass die Welt um uns so funktioniert: Dauernd ändert sich was, dauernd
müssen wir neue Sinneseindrücke verkraften, das Handy piept,
Schnellnachrichten, mal eben gucken…
Ich lerne gerade neu, mich auf einen Menschen zu konzentrieren. Natürlich habe
ich auch früher schon zugehört, mich auf die Menschen eingelassen. Aber es ist
nun deutlich anders: eine kleine Ablenkung beim Telefonat, und man verliert den
Faden. Wenn das Lächeln die Augen nicht erreicht, erkennt man es bei
Maskenträgern nicht. Eine Begrüßung funktioniert nur noch, wenn man sich drauf
konzentriert und nicht schon in Gedanken beim nächsten ist. Das alles ist auch
eine Chance, finde ich: man muss mehr Antennen ausstrecken, um mitzukriegen,
was der oder die andere fühlt, was zwischen den Zeilen steht – und das ist eine
Wohltat. Es tut gut, wenn Menschen sich konzentrieren auf den oder die eine
Gesprächspartner*in, die gerade wichtig sind – man fühlt sich deutlich anders
wahrgenommen. Und es reicht nicht mehr, oberflächlich zu agieren, nur mit dem
Mund zu lächeln – wenn Mimik wegfällt, werden die Augen noch mehr zum Spiegel
der Seele.
Vielleicht hilft uns das, wieder
authentischer zu werden, inne zu halten, konzentrierter bei der Sache zu sein –
es wäre schön, wenn das über die Krise hinaus hielte.