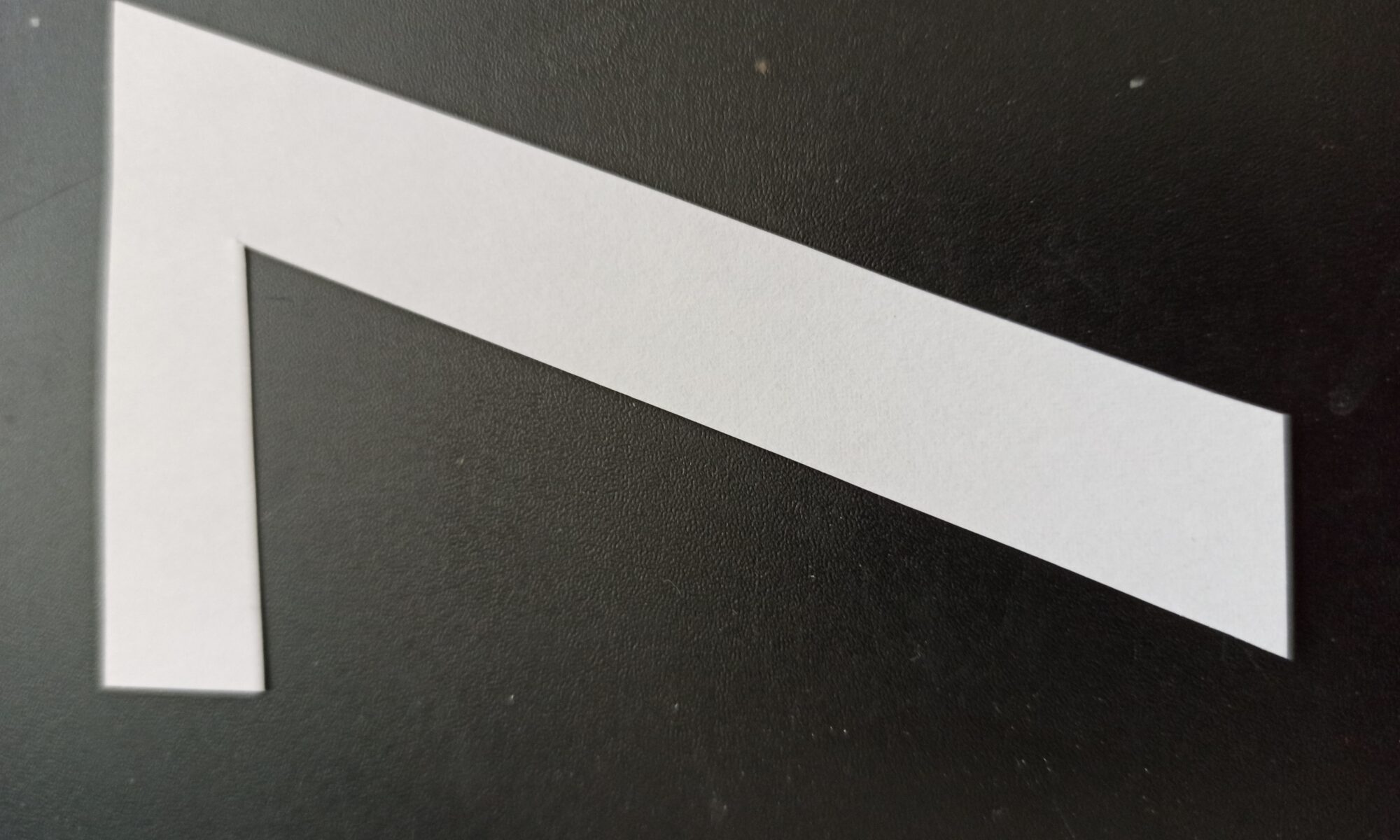Das, was sich unter Corona schon andeutete, verschärft sich
ungemein: alle fallen übereinander her und beschimpfen sich gegenseitig,
Argumente interessieren niemanden mehr. Die einen schimpfen über die, die
Waffenlieferungen befürworten und werfen ihnen Kriegstreiberei vor. Die anderen
schimpfen über die, die den Pazifismus verinnerlicht haben, als feige
Nichtstuer auf dem Sofa, die schon den zweiten Weltkrieg verursacht hätten und
schuld wären am Leid der Juden. Jeder glaubt, er hätte den Königsweg gefunden.
In Talkshows hört man nur noch militärische Begriffe, jeder ist nun
Panzerexperte, wer sich nicht öffentlich dazu bekennt, wird als mildschuldig am
Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer bezeichnet. Dabei ist die Wahrheit doch
viel vielschichtiger – und keiner, der aus echter Überzeugung argumentiert,
macht es sich „leicht“. Herr Hofreiter von den Grünen hat es in einem Statement
mal so ausgedrückt: ich habe Respekt vor denen, die nach Abwägung aller
Argumente Pazifisten bleiben und Waffenlieferungen ablehnen, nur ich komme zu
einem anderen Schluss.
Ich oute mich jetzt: ich bin gegen Waffenlieferungen. Ich glaube immer noch,
dass mehr Waffen noch mehr Leid bringen und dass auch die russischen Soldaten,
die sterben, ein Lebensrecht haben. Ich glaube allerdings auch, dass die
Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht hat und natürlich verurteile ich Putin als
Aggressor. Und da ist schon mein Dilemma: wer sich selbst verteidigen muss,
sollte die Möglichkeiten haben: und sei es entsprechende Waffen. Aber: Ich erkenne
nicht, dass Waffen Frieden bringen könnten – und ich bin der Ansicht, dass wir
längst auch Sanktionen vornehmen müssten, die unserer Wirtschaft schaden: das
Geld, um das sozial (bitte nicht mit der Gießkanne) abzufedern könnte man aus
dem jetzt beschlossenen Sonderfonds für die Bundeswehr nehmen. (Denn: es
mangelt der Bundeswehr ja gar nicht an Geld, sie kann nur nicht damit umgehen,
auch da sind die Gründe vielschichtig und systemimmanent.) Wir können
russischen Soldaten eine goldene Brücke bauen und Asyl anbieten, damit
Desertation nicht in ukrainischen Kriegsgefangenenlagern endet. Es gäbe noch
eine Menge Dinge auszuprobieren, finde ich.
Pazifismus ist schwierig in Kriegszeiten, keine Frage. Aber in Friedenszeiten
könnte man deutlich mehr tun, auch für den Weltfrieden, auch gegen solche
Diktatoren wie Putin: nur, dass uns immer das Wirtschaftswachstum in die Quere
kommt, es darf nichts kosten. Auch nach der Annexion der Krim haben „wir“
Geschäfte mit Russland gemacht und keinerlei Anstrengungen unternommen, die
Abhängigkeiten zu verringern. Wir schauen weg, wenn Nato-Partner Kriege
beginnen oder, wie Erdogan zurzeit, im Nachbarland Bomben auf Kurden schmeißen.
Wir haben zugesehen, wie die USA auf Grund falscher Behauptungen Kriege
angefangen haben. Wir haben uns – humanitäre Beiträge mal abgesehen –
weitgehend rausgehalten, immer unsere Wirtschaft im Blick: was ist an diesem
Krieg so anders, dass man alle Grundsätze über den Haufen schmeißen muss, nur
den Blick auf die Wirtschaft nicht?
Pazifismus bedeutet, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, überall auf der Welt.
Das kostet Geld, das geht an die eigene Bequemlichkeit. Pazifismus bedeutet,
den Klimawandel im Blick zu haben und aufhalten zu wollen: das geht nicht, wenn
man den Status Quo erhalten will.
Geschichte wird von Siegern geschrieben. Auch unsere. Wenn man genau hinschaut,
dann kann man eine Menge kritisieren an der Aussage: das militärische
Einschreiten der Alliierten hat Hitlerdeutschland beendet und den Frieden
gebracht. Ja, wir hier, in Westdeutschland, haben im Frieden gelebt, lange
Jahre. Im Osten Europas war das deutlich anders – es sei denn man definiert
Frieden lediglich als Abwesenheit von Krieg. Auch da ist die Wahrheit deutlich
vielschichtiger.
Ich verstehe jeden, der sagt: wir müssen Waffen liefern, damit die Ukraine
gewinnen kann, denn Putin marschiert weiter. Ja, vielleicht tut er das:
allerdings wären als nächstes Nato-Länder dran und da ist dann doch das
Narrativ der Abschreckung? Ich verstehe auch jeden, der sagt, dass wir Waffen
liefern müssen, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern: auch da allerdings
frage ich mich, ob das nicht gerade dazu führen könnte? Ich weiß es nicht.
Ich verstehe auch jeden, der sagt, wir müssen Waffen liefern, damit die
Menschen nicht in einer Diktatur leben. Ja, auch da gehe ich mit: auch ich will
nicht, dass die Ukraine eine Diktatur unter russischer Aufsicht wird. Ich sehe
nur, dass wir vorher zugelassen haben, dass Menschen in Russland selbst oder in
ehemaligen sowjetischen Republiken so leben müssen – und weiter nur unsere
Wirtschaft im Blick gehabt haben.
Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich sehe nur, dass Waffen keinen Frieden
bringen – und ob sie Putin zurück an den Verhandlungstisch bringen, bezweifle
ich: hoffe aber, dass ich Unrecht habe.
Worauf ich allerdings mit diesem Text hinaus will, ist folgendes: Niemand, der
sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, macht es sich leicht. Niemand, egal,
wie sein oder ihr Fazit sein wird, weiß, ob er oder sie recht hat. Es gibt so
Entscheidungen, die immer falsch sind. So oder so.
Und daher wünsche ich mir etwas mehr Respekt von beiden Seiten. Denn eins ist
klar, Menschen, die nicht einmal untereinander Frieden halten können, die den
Respekt den Nächsten gegenüber verloren haben, die sind nicht geeignet Frieden
zu schaffen, egal, auf welcher Seite sie stehen.
Es mag abgedroschen sein: aber Frieden fängt im Kleinen an. Wenn wir uns
zerstreiten, ist das ein Sieg Putins.
Fangen wir wieder an, einander wirklich zuzuhören. Versuchen wir, einander zu
verstehen: das muss man wollen. Versuchen wir, unsere Ansicht, unser Ringen
darum, was richtig ist, zu erklären. Im Endeffekt wollen wir alle das gleiche:
dass dieser Krieg aufhört, dass der Angriff auf einen souveränen Staat auch
über ein Ende des Krieges hinaus Thema bleibt, geächtet wird und mit
friedlichen Mitteln diese Ächtung auch zum Ausdruck gebracht wird. Dass die
Ukrainer in ihre Heimat zurückkehren können als freie Menschen. Dass das Töten,
dass sinnlose Sterben von jungen Männern und Frauen, die doch auch nichts
anderes wollen als leben, endlich ein Ende hat.
Wir streiten über die Wege dahin: dass ist legitim. Aber wir sollten immer
wissen, dass niemand sich die Entscheidung leicht macht, dass wir alle um den
richtigen Weg ringen.
Das könnte unser Beitrag zum Frieden in der Welt sein. Lassen wir Putin nicht
gewinnen.
Schwerter zu Pflugscharen – persönliche Gedanken zu Krieg und Frieden
Ich bin mit 17 das erste Mal auf die Straße gegangen, um für den Frieden zu demonstrieren. Im Rahmen des Krefelder Appells gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland. Es folgten viele friedensbewegte Aktionen und Demos, in Krefeld, in Bonn, an der Selfkant – überall, wo erreichbar etwas stattfand. Wir hatten ehrlich Angst vor dem Dritten Weltkrieg und vor Atomraketen und sangen Lieder vom Frieden ohne Waffen: überzeugt, dass das der einzige Weg ist, Frieden in die Welt zu bringen. Als dann Ende 1989 die Mauer fiel, völlig unmilitärisch, nach friedlichen Protesten, habe ich geweint: die Einteilung der Welt in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß schien mir überwunden.
In den weiteren Jahren etablierten sich die USA als Weltpolizei, die darüber entscheidet, wer gut und wer böse ist, gerne auch mal mit Militärgewalt, gerne auch mal auf Grund von Lügen: wieder trieb es uns auf die Straße, im ersten Irakkrieg (1990) hängten wir weiße Betttücher aus dem Fenster als Zeichen, dass wir gegen diesen Krieg waren und morgens im Morgenmagazin konnten wir dem Krieg sogar zuschauen: Dieser Krieg war weit weg und doch irgendwie gruselig nahe, aber er ging uns im Prinzip „nur“ etwas an, weil wir immer noch auf den Weltfrieden hofften und glaubten, der größte Teil der Welt habe den Krieg überwunden. Gleichzeitig mische sich die „westliche Welt“ mit der NATO in den Jugoslawienkrieg ein in dem ohne Zweifel große Grausamkeiten geschahen: ob das Einschreiten der NATO irgendwas befriedet hat und ob er überhaupt gerechtfertigt war, wird bis heute auch von Völkerrechtlern bezweifelt. Dieser Krieg war uns wieder näher: war doch Jugoslawien Urlaubsort für viele Menschen, und als ich in einem Sommer Anfang der 90er in Lienz an der Drau stand, die ja Richtung Jugoslawien fließt, wurde mir das so richtig bewusst.
In Deutschland haben wir Frieden seit 1945. Wir waren zwar in Kriege verwickelt, hatten Minister, die sagten, man müsse Deutschland auch am Hindukusch verteidigen (welches Elend das ausgelöst hat, konnten wir ja nun vor kurzem gut erkennen), aber wir selbst wandten uns anderen Themen zu, durchaus auch wichtig: dem Umweltschutz, der Gerechtigkeit auch für die ärmsten Länder der Welt, der Frage, wo wir auf Kosten anderer lebten, dem Klimaschutz: auf die Straße gingen wir weiter, bis heute, die Zeit der großen Friedensdemos, die immer ausdrücklich auch Antikriegsdemos waren und den Rüstungswettlauf kritisierten, war vorbei.
Auch 2014, als Putin in die Krim einmarschierte, waren wir zwar entsetzt, ließen uns aber überzeugen, dass dort hauptsächlich Russen lebten, die gerne wieder zu Russland gehören wollten – und die wohl vielleicht auch in der Ukraine nicht sehr willkommen waren. Und auch das Verhalten der NATO war damals nicht ok, so dass wir uns lieber nicht zu einseitig positioniert haben.
Vor einer Woche ist Putin vom Verhandlungstisch aufgestanden und hat seine Truppen Richtung Ukraine in Bewegung gesetzt, wohl in dem Glauben, dass die Ukrainer in Scharen zu ihm überlaufen.
Und ich sitze jetzt hier, fühle mich in die 80er zurückversetzt und frage mich, ob das ganze „Frieden schaffen ohne Waffen“ nur eine naive Träumerei ist, ob Pazifismus zum Untergang führt.
Vorab: ich habe jedes Verständnis dafür, dass die Ukrainer sich verteidigen. Auch wenn ich nicht durchblicke ob und wenn ja wie großen Anteil die Ukraine an diesem Krieg hat: nichts rechtfertig den Einmarsch in ein unabhängiges Land. Ich glaube dennoch, dass Pazifismus der einzige richtige Weg ist. Konventionelle Kriege können keine Lösung mehr bieten. Und Atomkriege – die würden uns alle vernichten.
Ich glaube, dass wir jetzt nicht anfangen sollten, Waffen in Krisenherde zu liefern, im Glauben, „die Guten“ zu unterstützen, auch wenn ich verstehe, warum dies geschieht: Jede Waffe generiert mehr Tote, und je mehr Menschen sterben, desto unmenschlicher wird der Krieg. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt anfangen sollten, Deutschland aufzurüsten und die Bundeswehr neu aufzustellen. Ich glaube, wir müssen das Geld in die Hand nehmen für die Friedensarbeit, für Gerechtigkeit, für Klimaschutz: da, wo Menschen frei und in Frieden leben können und nicht um ihr Auskommen fürchten müssen, da, wo Menschen in der Lage sind, nicht auf jeden Populisten reinzufallen, da, wo Gleichheit und Gerechtigkeit für alle verwirklicht wird ist kein Nährboden für Krieg. Dazu gehört aber auch, dass ich mir überlegen muss, wie mein konkretes Leben aussehen muss, damit diese Gerechtigkeit verwirklicht wird. Dazu gehört auch, dass mir klar wird: solange wir von Diktatoren wirtschaftlich abhängig sind, weil wir ihr Gas und ihr Öl nutzen, so lange werden sie ihr Spiel mit uns treiben und wir werden weiter schweigen zu Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung.
Ja, es kann sein, dass sich mein Leben grundlegend ändern muss. Dass die Zeit des friedlichen Wohlstandes vorbei ist. Schließlich gibt es auch bei uns Menschen, die wir mittragen müssen, wenn es finanziell schwierig wird.
Ich bleibe dabei: Waffen schaffen keinen Frieden. Gerechtigkeit und Klimaschutz sind der einzige Weg.
Dafür will ich mich weiter einsetzen. Für diesen Frieden gehe ich weiter auf die Straße.
Zwischen den Jahren – Betrachtungen
Rauhnächte nannte man diese Zeit früher: der Vorhang zwischen unserer Welt und der Anderswelt sei besonders dünn, so die Sage, und daher treiben Unholde sich in unserer Welt rum und treiben ihren Spaß mit den Menschen.
Zwischen den Jahren: eine Zwischenzeit, eine Anderszeit, so empfinden es sicher viele: Zeit des Rückblicks aber auch des Blickes in die Zukunft…
„Glauben Sie wirklich Gott und an das ewige Leben“ – diese Frage stellen Angehörige von Verstorbenen gerne, wenn sie selbst kirchenfern für ihre Eltern oder andere Angehörige eine kirchliche Beerdigung wünschen – weil diese das so gewollt hätten.
Für mich immer wieder neu, darüber nachzudenken, woran ich wirklich glaube. Und ja, ich glaube, dass es irgendwie weitergeht nach dem Tod, und ich glaube auch, dass wir irgendwie verbunden bleiben mit den Menschen, die wir hier auf Erden geliebt haben. Durch die Erinnerung, durch die Liebe, die wir durch sie empfangen durften oder mit der wir sie geliebt haben. Durch ein Band, dass im Leben geknüpft wird und der Tod nicht trennen kann. Ich stelle mir gerne eine Lichtung vor, auf der anderen Seite des Flusses, wo die Menschen mit Gott zusammenleben im immerwährenden Frieden.
Und ja, ich weiß, dass das nur eine Vorstellung ist, eine Projektion meinerseits. Vielleicht ist alles ganz anders. Niemand, auch der Frömmste egal welcher Religion, weiß, was mit uns passiert, wenn wir sterben. Aber ich glaube, dass wir alle von Gott gewollt sind und daher weiterleben werden.
Ich glaube nicht an einen personalen Gott, der in die Welt eingreift, der Menschen krank macht oder gesund, der die einen sterben lässt und die anderen Leben, die einen siegen und die anderen verlieren. Aber ich glaube an ein göttliches Wesen, das Vater und Mutter gleichzeitig ist, dass uns trägt, wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren, das bei uns ist, wenn wir Angst haben, wenn wir nicht mehr weiterwissen und uns stärkt, wenn wir in der Dunkelheit uns zu verirren drohen.
Und ich glaube, dass es unwichtig ist, ob und wie wir an Gott glauben: er glaubt an uns.
Und so wünsche ich mir und allen, die dies hier lesen, dass wir getragen in das neue Jahr gehen können und trotz aller Dunkelheit um uns her das Licht der Hoffnung erkennen.
Tag der Menschenrechte im Advent 2021
Europa – und allen voran Deutschland – bekennen sich zu den Menschenrechten. Dazu gehören verschiedene bürgerliche und politische Freiheitsrechte und Beteiligungsrechte sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Unter anderem hat jeder Mensch ein Recht auf Leben, Gesundheit, Arbeit und Wohnen, auf Bildung, auf Gleichheit vor dem Gesetz, hinzu kommen das Verbot der Folter und die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit und die Religionsfreiheit. Seit 2010 ist auch Zugang zu sauberem Wasser ein Menschenrecht. Zurzeit wird diskutiert, ob es ein Recht darauf geben soll, in sauberer Umwelt zu leben.
So weit, so gut. Gleichzeitig spielen sich an Europas Außengrenzen Dramen
ab, bei denen alle diese Rechte, allen voran das Recht auf Leben, mit Füßen
getreten werden: an der Grenze zwischen Polen und Belarus, in den griechischen
Lagern, auf dem Mittelmeer: überall sterben Menschen, erfrieren, ertrinken,
verhungern, sterben an fehlenden Zugang zur Gesundheitsfürsorge und an
vermeidbaren Erkrankungen, die auf mangelnde oder gar nicht erst vorhandene
sanitäre Einrichtungen etc. zurückgehen.
Von Arbeit, Wohnen, Bildung und so weiter gar nicht erst zu reden. Auch die
Pressefreiheit wird mit Füßen getreten und Journalisten die Berichterstattung
gewährt.
Und wir? Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, auf das Fest des Friedens, der Familie, auf das Fest, an dem der Erlöser und Friedensfürst, wie Christen glauben, Mensch wird.
Aber was können wir tun, werden Sie und Ihr jetzt zurecht fragen. Mir fällt da gerade so einiges ein: Organisationen unterstützen, die vor Ort Hilfe leisten wie z.B. Sea-Watch oder Ärzte ohne Grenzen. Petitionen unterschreiben. Unterschriften sammeln. Mails und Briefe an Entscheidungsträger schicken.
Und, ganz wichtig: den Mund aufmachen, wenn Menschen richtig finden, was da passiert, wenn sie von „selbst schuld“ reden, von Sozialtourismus und ähnlichen Dingen: Kein Mensch begibt sich in Lebensgefahr um zwei Cent mehr in der Tasche zu haben. Diese Menschen wollen nichts anderes als das, was ihnen zusteht: die Wahrung ihrer Menschenrechte, ein Recht auf Leben und Gesundheit, Arbeit und Wohnen, auf Bildung, Gleichheit vor dem Gesetz, kurz gesagt auf eine menschenwürdige Zukunft.
Wenn wir den Mund aufmachen, nicht um jemanden niederzuschreien, sondern mit sachlichen Argumenten, wenn wir denen hörbar entgegentreten, denen das Schicksal der Geflüchteten bestenfalls egal ist und die oft auch mit falschen Fakten agieren, dann tragen wir dazu bei, dass mehr Menschen ein Lebensrecht bekommen.
Und wenn wir unseren Lebensstandard und unsere Gewohnheiten daraufhin überprüfen, welche negative Auswirkung auf das Leben anderer Menschen dadurch bedingt sind und wie wir das ein oder andere ändern können, dann ist das ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Dann tragen wir mit dazu bei, dass die Menschheit das verwirklicht, wozu sie sich bekannt hat: zur Einhaltung der Menschenrechte.
Gedanken zu St.Martin
Niederrhein. Heute ist St. Martin. Überall ziehen, zumindest in diesen Breiten hier, Martinszüge durch die Städte, und die Story vom Teilen wird Kindern nahegebracht: trotz Eiseskälte hat St. Martin seinen Mantel geteilt mit dem armen Bettler am Straßenrand (man kann darüber diskutieren, ob er es durfte oder ob es ihm sogar leicht viel, weil der Mantel seinem Arbeitgeber gehörte, aber sei es drum 😉 ).
Marin von Tours hat es wirklich gegeben – wieviele der Geschichten, die über ihn erzählt werden, einen Wahrheitsgehalt haben, weiß niemand so genau. Sulpicius Severus, einer seiner Weggefährten, schrieb einige Begebenheiten seines Lebens nieder. Sicher ist: Martin war vor Ablauf seiner Soldatenzeit ein hochrangiger Militär und hat, als er Christ wurde, versucht, vorzeitig aus dem Armeedienst auszusteigen. Sein Ziel: den Menschen zu helfen.
Ortswechsel: Grenze zwischen Polen und Belarus. Viele verzweifelte Menschen versuchen, an der Grenze in die EU zu gelangen, um einen Asylantrag stellen zu können. Sie kommen aus Afghanistan, aus dem Irak, und sie wollen eins: in Sicherheit leben können. Polen tut alles, die Flüchtlinge zu vertreiben, und geht dabei noch weiter, als es bisher üblich ist: neben illegalen Pushbacks, die von Amnesty International dokumentiert sind, wird ihnen Wasser und Nahrungsmittel verweigert und insbesondere auch die ärztliche Versorgung. Die Dokumentation vor Ort ist schwierig, weil auch Anwält:innen und Journalist:innen der Zugang blockiert wird, trotz einer eindeutigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Aber manches dringt eben doch durch: Anwohner der dünnbesiedelten Zone erzählen von verhungernden Menschen, von dünnen Pullovern in Eiseskälte und schrecklichen Zuständen. Einer der Toten war Gailan Ismail, 26 Jahre alt, aus dem Irak: er starb, weil ihm medizinische Hilfe verweigert wurde. Er war auf dem Weg zu Verwandten nach Krefeld, wo er ein neues, sicheres Leben anfangen wollte.
Ortswechsel: EU. Die Politikerinnen und Politiker der EU gucken nicht weg. Sie schauen hin, debattieren und stellen dann fest: Polen soll fest bleiben, Lukaschenko soll aufhören, die Flüchtlinge zu schicken, und auf keinem Fall will man sich von ihm erpressen lassen. Das die Menschenrechte auch von Polen und somit von der EU mißachtet werden, dass das europäische Asylrecht ausgehebelt wird, wenn man die Menschen mit Gewalt davon abhält, europäischen Boden zu betreten – wen interessierts? Menschen werden zum Spielball politischer Kräfte. Sie werden quasi entmenschlicht, die Sprache, auch in den Medien, ist schon wieder entsprechend: von Flüchtlingsströmen ist die Rede, von Ansturm, von Durchbruch…
St. Martin teilt den Mantel mit dem Bettler. Das christliche Europa feiert ihn, heute. Während dessen lassen wir Menschen an unseren Grenzen erfrieren. Und die, die, zumindest im Internet, laut schreien, dass St. Martin St.Martin bleiben muss, tönen mit Blick auf die frierenden Menschen dort an der Grenze: „Wer sich in Gefahr begibt kommt darin um“.
Die Botschaft von St. Martin spielt da
keine Rolle mehr: wir beschränken Teilen und Mitgefühl auf Folklorefeste.
(Quellen: z.B. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/polen-belarus-migranten-durchbruch-grenzsicherung-russland-100.html; https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-belarus-123.html; https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/polen-belarus-afghanische-asylsuchende-rechtswidrige-push-backs; Seebrücke Krefeld)
Worte statt Wörtern
Ich bin ja Christin. Und ich befasse mich regelmäßig mit den Texten der katholischen Sonntagsliturgie. Letzen Sonntag war das Evangelium an der Reihe, in dem Jesus einen Taubstummen heilt. Der Schlüsselsatz in meinen Augen ist folgender: „Jesus seufzte und sagte zu ihm Effata, das heißt: öffne Dich! Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden“ (Mk 7,34bf)
Mir kam in den Kopf, dass ich immer wieder feststelle: wenn mir die Worte fehlen (und die Ereignisse der letzten Zeit: der Blick nach Afghanistan, auf den Klimawandel, auf den Wahlkampf und Querdenker, z.B. führen dazu), wenn ich nichts mehr hören oder lesen will weil ich es nicht ertrage, dann prodziere ich Wörter – weil ich eigentlich sprachlos bin.
Mit diesen Gedanken habe ich folgenden Text geschrieben:
Wenn mir Worte fehlen
stürze ich mich auf Wörter
Wenn mir alles zu viel wird
verschließe ich meine Ohren
Ich will nichts mehr hören
Ich kann nichts mehr sagen
Hilflos drifte ich durch die laute Stille
Aus meinen Wörtern
sollen Worte werden
Meine Ohren will ich öffnen
hinhören und zuhören
Meine Augen nicht verschließen
sondern hinsehen
Dann wird meine Hilflosigkeit
sich wandeln
ich werde hören und sehen
wo Hilfe nottut
ich werde Worte finden
die aufrütteln
trösten
helfen
Antikriegstag
1. September 1939 (also heute vor 72 Jahren): Seit 5 Uhr 45 wird
zurückgeschossen hieß es – und hinter dieser Floskel verbarg sich der Angriff
auf Polen.
Heute ist Antikriegstag in Deutschland. Ein Anlass, mal wieder über den Frieden
nachzudenken: „Frieden (von althochdeutsch fridu „Schonung“,
„Freundschaft“) ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille
oder Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg.
Frieden ist das Ergebnis der Tugend der „Friedfertigkeit“ und damit verbundener
Friedensbemühungen. Friede ist im heutigen Sprachgebrauch der allgemeine
Zustand zwischen Menschen, sozialen Gruppen oder Staaten, in dem bestehende
Konflikte in rechtlich festgelegten Normen ohne Gewalt ausgetragen werden. Der
Begriff bezeichnet einen Zustand in der Beziehung zwischen Völkern und Staaten,
der den Krieg zur Durchsetzung von Politik ausschließt.“ (Auszug aus Wikipedia)
Was bedeutet das für uns hier in Deutschland und in der ganzen Welt? Nun, seit Kriegsende hat es auf deutschem Boden keinen Krieg mehr gegeben. Ob man die Zustände in der ehemaligen DDR unter obige Definition packen kann, darüber maße ich mir kein Urteil an: die damalige Staatsführung jedenfalls hat es wohl so gehalten. Allerdings ist Frieden ja deutlich mehr als nur die Abwesenheit von Krieg – und da sehe ich die Querdenkerdemos auf unseren Straßen, höre die Menschen, die sich diskriminiert fühlen, weil sie sich nicht impfen lassen möchten, und sehe den Hass auf Geflüchtete (und ja, auch Krawalle des sogenannten schwarzen Blockes, wenn auch meist weniger lebensgefährlich für einzelne Menschen, schließe ich da bewusst nicht aus).
Die Sprache wird rauer, in den sozialen Netzwerken, aber auch im realen Leben. Im Bundestag sitzen Menschen, die allen Ernstes behaupten, wir lebten in einer Diktatur. Es gibt den strukturellen Rassismus, und er fällt uns gar nicht immer auf. Dies und viele weitere Anzeichen deuten darauf hin, dass es mit dem Frieden noch nicht so richtig klappt bei uns.
Der Blick in die Welt zeigt dann dramatisch: friedlich ist sie nirgends. Und immer noch werden Vorwände genutzt, um Krieg zu führen, und die eigentlichen Gründe (die meist aus Machtstreben, Zugang zu strategisch wichtigen Orten oder Bodenschätzen bestehen) werden so vorsichtig verschleiert.
Was aber kann ich tun (außer vielleicht beten?). Nun, ich kann, so kurz vor der Bundestagswahl, Wahlprogramme und Kandidatinnen und Kandidaten darauf abklopfen, ob ihre Vorstellungen und politischen Werte friedensfördernd sind (Stichworte: Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Migration…)
Und ich kann mein eigenes Leben überprüfen: trage ich zum Frieden in meinem Umfeld bei? Oder hab auch ich Gewohnheiten, die dem entgegenstehen. Wie begegne ich meinem oder meiner Nächsten, und zwar nicht nur denen, die ich mag oder mit denen ich mehr oder weniger notgedrungen auskommen muss sondern auch denen, die ich nicht leiden kann. Oder die mein Leben stören – gefühlt oder aber auch real…
Friede kann ausstrahlen und sich weiter fortsetzen. Grundlage für alles ist die Liebe zu den Menschen. Studien haben herausgefunden (aber da braucht man eigentlich keine Studien zu) dass aus Kindern, die sich geliebt fühlen dürfen, meist emphatischere und den Menschen zugewandtere Erwachsene werden als aus Kindern, die diese Liebe nicht oder nur sehr selten spüren. Bei Liebe und Frieden funktioniert das Schneeballsystem durchaus.
Das Bild zeigt die – reparaturbedürftige – Friedensglocke in Mösern in Tirol
7
in Worten: sieben
Die Zahl des Tages
Ich bin sprachlos
Menschen rennen um ihr Leben
hängen sich an Flugzeuge
fallen runter, sterben.
640 im überfüllten US-Transportflugzeug
Die Bundeswehr rettet 7
Die waren berechtigt
Auffüllen mit denen die da sind?
Es braucht Visa
Und den richtigen Arbeitgeber
Deutschland kann nicht alle retten
Und wer überhaupt schafft es noch
Der Flugplatz ist fast nicht mehr zu erreichen
Wer für Deutsche gearbeitet hat
Wird als Verräter angesehen
Verrätern droht die Todesstrafe
Deutschland lässt sie sterben
Ich bin sprachlos
Die Zahl des Tages
7
Was ist eigentlich Hoffnung?
Worauf hoffen Sie? So fragt public forum in Heft 12/21 auf Seite 50 die Leserinnen und Leser unter dem Titel „Hoffen über die Pandemie hinaus“. Ein Satz sprang mir ins Auge: „Wann immer jemand mit der Realität überfordert war… musste eben mehr oder weniger untätig gehofft werden“ – und der stieß mir auf, habe ich doch selbst Anfang des Jahres „Hoffnungsbriefe“ verschickt an Menschen, die ich kenne, nach dem Losprinzip. Grund genug für mich also, mich dem Thema Hoffnung zu widmen.
Was ist Hoffnung eigentlich? „Hoffnung
ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven
Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass
wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das kann ein bestimmtes Ereignis sein,
aber auch ein grundlegender Zustand wie etwa anhaltende Gesundheit oder
finanzielle Absicherung. Hoffnung ist die umfassende emotionale und unter
Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Hoffend
verhält sich der Mensch optimistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz“ finde
ich als Definition bei WikiPedia. Ah ja. Also doch etwas Positives? Oder eher
eine Art Resignation?
Manche erinnern sich vielleicht an meinen Text hier vor ein paar Monaten, in
dem ich versuchte, etwas Aufmunterndes zu schreiben in einer Zeit, irgendwann
vor Ostern, als alles nur noch schlimmer wurde. Ich schrieb am Ende:“ Mehr kann ich
Euch heute nicht geben. Mehr habe ich selbst nicht.“ Das scheint mir die
Hoffnung, die die Dame aus dem Zitat gemeint hat – die Hoffnung, dass es, wider
Erwarten, besser werden kann, ganz ohne konkrete Anhaltspunkte. Und für mich
war es genau diese Hoffnung, die dafür gesorgt hat, dass ich nicht ganz
unterging im Tal der Tränen – der Grat war schmal, ich hatte Glück, ich bin
nicht abgerutscht. Eine Hoffnung, die auf nichts beruht außer dem Gefühl, dass
es einfach irgendwann besser werden muss. Eine Hoffnung, die sich auf nichts
gründet, auf keiner noch so vagen Gewissheit, die aber dennoch trägt.
Also mich. In
meinem Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass so viel dran ist an dieser
Liedzeile „life happens when you’re making plans“ (One Republic, Wild Life):
das Leben passiert, noch während wir Pläne machen. Und nicht immer geht, bei
aller Hoffnung, am Ende alles gut aus. Spätestens als mein Kind trotz all
meiner, all unserer Hoffnung vor der Geburt gestorben war, wusste ich, dass das
so ist. Wir alle haben wahrscheinlich den einen oder anderen Schicksalsschlag
erlebt, haben gehofft und doch verloren. Haben vielleicht am Krankenbett von
Freund:innen oder Verwandten gesessen, gehofft, vielleicht gebetet – aber der
Tod war stärker. Wie kann jemand, der so etwas erlebt hat, noch hoffen? Im März
war ich sehr nah dran an der Hoffnungslosigkeit – aber ich habe drauf vertraut,
dass sie wiederkehrt, die Hoffnung. Nun ist sie wieder da, vorsichtig, aber
doch ja.
Was ist also Hoffnung? Die Hoffnung stirbt zuletzt, wird immer gesagt. Hoffnung
ist das Vertrauen darauf, dass nicht alles vorbei ist. Das Vertrauen darauf,
dass es weitergeht, vielleicht nicht so bequem, vielleicht anders, aber weiter
geht.
Worauf ich hoffe: dass wir die Hoffnung nicht wieder verlieren. Dass immer
zumindest ein kleine Fünkchen bleibt, kein „es hät noch immer jut jejange“,
aber doch: bisher ging es immer irgendwie weiter. Eine Hoffnung, die uns nicht
resignieren lässt, sondern die uns fähig macht zu Handeln und mitzuarbeiten an
einer besseren Zukunft.
Gedanken an einem Sonntag im Mai 2021
Muttertag. Der Tag nach dem 8. Mai – Tag der Befreiung. Der Tag, an dem die Kontaktsperren und Ausgangssperren für Geimpfte aufgehoben wurden und die Testpflicht.
Mai. Der Monat, in dem die Natur explodiert. Der Monat, in dem die Kirche Maria, die Mutter Gottes ehrt – und in dem Maria 2.0 ihren Ausgangspunkt nahm. Der Monat, der in so vielen Liedern herbeigefleht wird: „Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün“ und lobend besungen „der Mai, und der war grüne…“.
Und ich sitze hier, an meinem Schreibtisch, vor dem offenen Fenster und hoffe auf den Frühlingstag, der uns versprochen wurde, und mache mir so meine Gedanken. Der Gottesdienst war, wie immer seit über einem Jahr, ein Hausgottesdienst, und das Evangelium endete mit den Worten: Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt (Joh 15,17).
Und mir geht durch den Kopf, dass das der Schlüssel ist. Menschen, die sich lieben, die sich wirklich lieben, tun einander nichts. Es geht um echte, selbstlose Liebe, nicht um die „wenn Du mich liebst dann…“- Liebe und auch nicht um die Liebe, die eine Gegengabe fordert.
Wenn wir Menschen einander lieben würden, dann gäbe es keine Kriege mehr. Wenn wir einander lieben würden, dann würden wir uns freuen für die, die jetzt wieder mehr dürfen. Und die wiederum, so sie ebenfalls ihre Mitmenschen lieben würden, agierten mit Augenmaß, so, dass sie uns nicht neidisch machen.
Wenn wir Menschen einander lieben würden, dann könnten Meinungen nebeneinander stehen bleiben, denn sie alle wären, so verschieden ihr Inhalt auch sein möge, als von der Menschenliebe getragen akzeptierbar. Wir würden nicht mehr Religionen gegeneinanderhetzen und in der Kirche mit Machtworten agieren müssen.
Von der Liebe getragen, könnten wir auch die verschiedenen Lebensweisen und Traditionen gut nebeneinanderstehen lassen – denn auch sie wären ja von der Liebe getragen.
Eine ideale Welt, die es so nicht gibt, das weiß ich auch.
Aber für mich kann ich daraus ziehen: jeder Mensch hat ein Lebensrecht, ein
Recht auf anderssein, ein Recht auf eigene Meinung, auf anderes Denken und
andere Traditionen. Solange das nicht menschenverachtend wird, kann ich diskutieren,
mich daran reiben, Argumente bringen: aber sachlich und höflich, denn auch der
oder die andere hat ein Recht darauf, mir gegenüber wiederum Argumente zu
bringen, meine Argumente zu widerlegen. Es ist wichtig, dass wir dies (wieder)
lernen. Und ich bin überzeugt: auch wenn ich nur in meiner kleinen Umwelt
agieren kann, so ist es doch so, wie Dom Helder Camara, der brasilianische
Erzbischof und Befreiungstheologe (1909-1999) gesagt hat: „Wenn eine allein
träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang
einer neuen Wirklichkeit.“
Lassen wir uns also von der Liebe tragen, lassen wir
sie wachsen, wie die Natur wächst in diesen Tagen – lassen wir uns vom Mai
inspirieren.