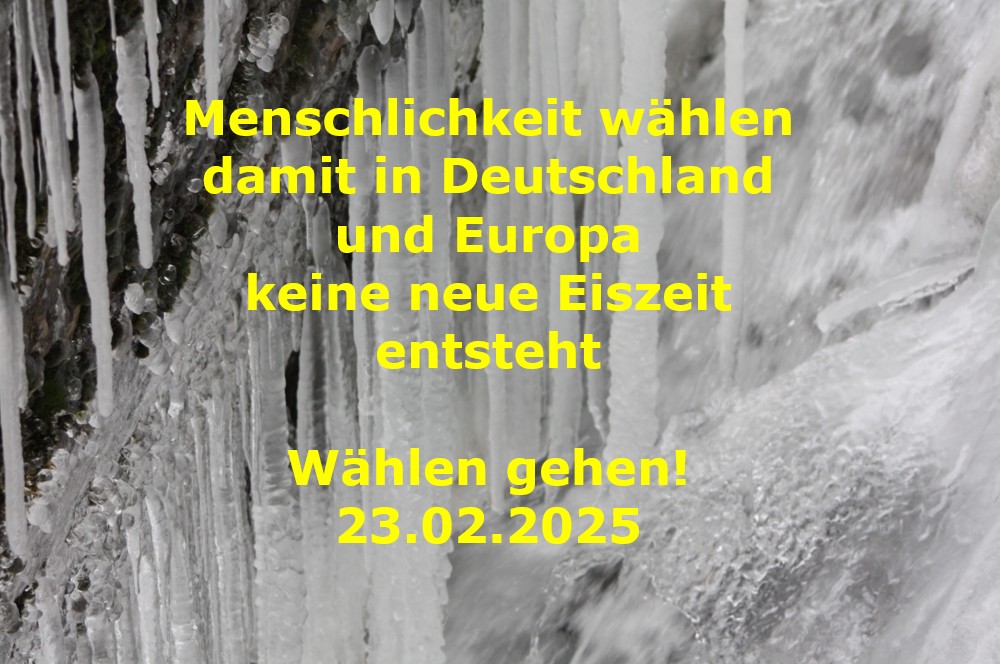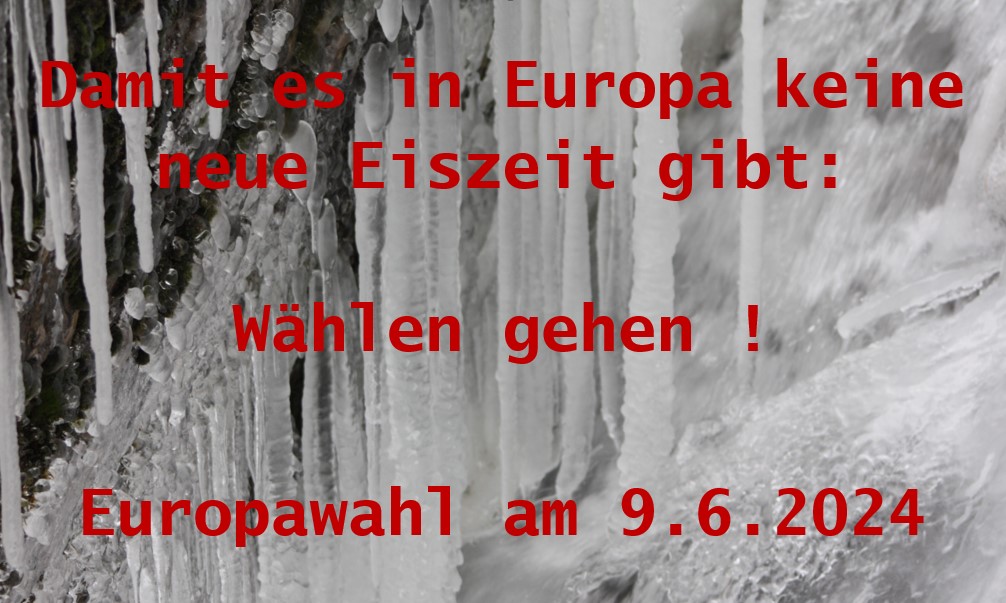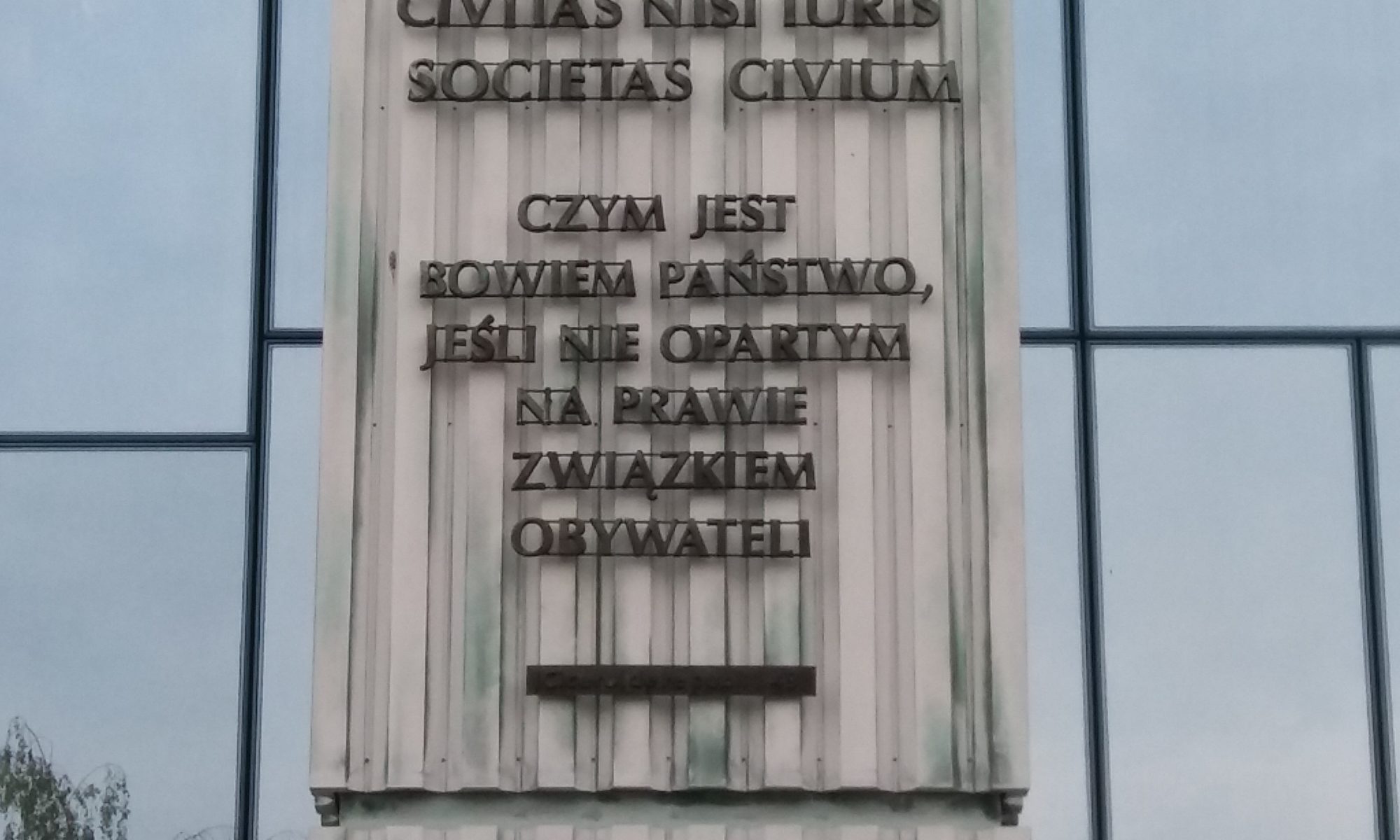Eigentlich glaube ich an unsere Demokratie und den Rechtsstaat. Eigentlich. Eigentlich habe ich auch daran geglaubt, dass, bei allen Schwächen, die USA eine rechtsstaatliche Demokratie sind. Eigentlich.
Sätze mit „eigentlich“ muss man „eigentlich“ nicht sagen, sagte unsere Gemeindereferentin immer: hatte sie recht?
Was in den USA passiert, macht mir Angst. Richter, die kriminelle Gewalttäter verurteilt haben nach dem Sturm aufs Pentagon werden kriminalisiert, die Täter begnadigt. Trump wird verklagt, aber es interessiert ihn nicht, weil er der Ansicht ist, dass alles, was „gut für das Land ist“, auch erlaubt sei. Die Mannen des Elon Musk stürmen sämtliche Behörden, klauen Daten, die nicht mal der Präsident haben will, entlassen haufenweise Mitarbeiter – und manchmal stellen sie fest, dass diese ja eigentlich doch gebraucht würden, wie z.B. die Mitarbeiter, die für Atomwaffen zuständig sind, und stellen sie dann wieder ein…
Staaten klagen gegen die Regierung und müssen damit rechnen, dass sie zwar damit durchkommen, es der Regierung aber am Allerwertesten vorbeigeht.
Trump verhökert bei „Friedensgesprächen“ mit dem Aggressor Putin die Ukraine, ohne dass diese beteiligt wird und beschimpft den Präsidenten als undemokratisch, obwohl während eines Krieges fast nirgendwo Wahlen stattfinden.
Er träumt davon, Grönland einzunehmen und den Gazastreifen zu entvölkern, um da ein Ressort für Reiche (Riviera des nahen Ostens) einzurichten, notfalls mit Waffengewalt. Wie, da leben Menschen? Ach, die kann man doch „umsiedeln“…
Rechtswidrig, Verstöße gegen die Verfassung, gegen das Völkerrecht: alles möglich. Die Bürgern seines Landes, den es ja eigentlich (da ist es wieder, dieses Wort) ab dem Tag eins nach seiner Wahl besser gehen sollte, geht es deutlich schlechter: die Lebensmittelpreise schießen in die Höhe, Menschen, die arbeiten, werden einfach so über die Grenze nach Mexiko geschickt, mit teilweise unmenschlichen Methoden. Aber die sind ihm ja auch wurscht, er brauchte sie als Stimmvieh, jetzt interessieren sie ihn nicht mehr und schon gar nicht die Oligarchen an seiner Seite.
Das sind die USA, könnte man jetzt sagen, wir aber leben in Deutschland. Wenn ich aber sehe, wie deutsche Politiker (und das sind jetzt nicht nur die der AfD) Trump verehren oder ihm zumindest bescheinigen, „einiges“ richtig zu machen (ok, das mit den Friedensverhandlungen ohne die EU, das nimmt man ihm schon ein bisschen übel, aber sonst), dann wird mir Angst und Bange. Wenn ich höre, dass die Polizei in Bayern Demos jetzt unterteilen muss in „normale Demos“ und solche, die sich „gegen CSU/CDU“ richten dann frage ich mich: wo war denn das Etikett „gegen die Grünen“ bei den Bauernprotesten? Da hat Aiwanger sogar mitgemacht. Und sie darf das anordnen, die Regierung, da es „intern“ ist, verstößt das angeblich nicht mal gegen den Gleichheitsgrundsatz. Und wenn in Bayern jetzt Referendarinnen ihr Referendariat nicht machen dürfen, weil sie aktiv bei den Fridays for Future sind und mal bei den Protesten der Extinction Rebellion (das bedeutet übrigens übersetzt Rebellion gegen das Aussterben) sich intensiv für die Natur und Klimaschutz eingesetzt hat, dann erinnert mich das an ganz dunkle Zeiten.
Merz redet immer von Notstand: Notstand, insbesondere innerer Notstand (nur um den kann es ja gehen) bedeutet nach § 91 GG gefährdete oder gestörte verfassungsmäßige Ordnung im Land (ugs. Unruhe oder Aufruhr). Na ja, wenn man Frau Klöckner, die ja wohl in der nächsten Regierung wieder Ministerin werden will, so hört und liest, sind die friedlichen, bunten Demos ja alle von linksradikalen Gewalttätern organisiert und die Teilnehmer*innen ordnet sie ebenso ein. Also mich. Meinen echt braven Mann. Meine Mama, die zwar nicht mehr hingeht ob ihres hohen Alters, aber gerne hingehen würde: jahrzehntelang hat sie die CDU gewählt und jetzt ist sie plötzlich linksradikal? Jedenfalls scheint die Union diese Demos bereits als Aufruhr zu werten, oder übertreibe ich da?
Und nein, ich will nicht noch mehr Morde in Deutschland. Aber auch keine von deutschen Mördern: es gab jede Menge Messerstechereien in diesem Jahr, die allermeisten Täter waren Deutsche, deshalb findet man darüber im Netz ziemlich wenig (Quelle Volksverpetzer).Nicht alles wird man verhindern können, aber schnellere Integration, auch in den Arbeitsmarkt, wäre ein Schritt in die richtige Richtung: bei uns im Camp sind haufenweise junge Männer, die nichts anderes wollen als arbeiten, sich selbst versorgen, Fuß fassen. Und doch müssen sie schon monatelang auf Deutschkurse warten, selbst die, bei denen eigentlich auf den ersten Blick klar ist, dass sie bleiben dürfen, z.B. Christen aus dem Iran, denen dort die Todesstrafe droht. Wer sich integrieren und arbeiten kann, kann sich deutlich leichter einfügen in die Gesellschaft als derjenige, der immer nur zusammengepfercht in einem Camp ohne Freizeitmöglichkeiten hockt.
Wer Traumata hat, der sollte psychologische Hilfe bekommen: auch da krankt es bei uns. Es gibt nicht genug Zulassungen, der Zugang zum Studium ist, genau wie in der Medizin, viel zu hoch und richtet sich nur nach Zeugnisnoten, nicht nach der Eignung.
Und – und das hat der Vorsitzende der NRW-Polizeigewerkschaft im Radio gesagt: die Polizei braucht mehr Mittel, ihre Aufgaben zu erfüllen. Er sprach nicht von neuen Gesetzen, sondern Geldern im Haushalt, die das ermöglichen würden. Sonntagsreden sind da nicht notwendig, auch neue Gesetze nicht: der Ruf nach innerer Sicherheit muss sich im Haushalt widerspiegeln.
Aber das ficht Merz nicht an, er will direkte Zurückweisungen an den Grenzen auch für die, die einen Schutzantrag stellen – absolut rechtswidrig, und, vor allem, undurchführbar: wo will er die Zollbeamten, Bundes- und Landespolizisten her nehmen, die jetzt schon überall fehlen? Der Attentäter von Magdeburg und der von München übrigens waren schon lange hier und nicht ausreisepflichtig, und zu dem von München gab es nicht mal irgendwelche Hinweise.
Zum ersten Mal in meinem Leben gucke ich nicht mit Sorge auf eine Wahl, sondern mit Angst. An den USA kann man sehen, wie leicht ein Rechtsstaat ausgehebelt werden kann. Statt gemeinsam gegen die AfD vorzugehen, beschimpft man lieber die anderen Demokraten (am allerliebsten die Grünen) – mit wem will man denn koalieren, wenn es so weit ist? Oder träumt man von der absoluten Mehrheit? Ich habe Angst vor einem „machen wir doch eine Minderheitsregierung, die AfD wird schon keinen Schaden anrichten“ – an eine etwaige Koalition „weil nix anderes geht“ will ich in meinen schlimmsten Albträumen nicht denken.
Zum ersten Mal in meinem Leben schwinden Hoffnung und Zuversicht, dass Deutschland auch nach dieser Wahl und auf Zukunft ein demokratischer Rechtsstaat bleibt, in dem es keine Deutschen zweiter Klasse gibt und niemand wegen seines Aussehens, seiner Herkunft, seiner Sprache, seines Geschlechtes oder sonstiger Abweichungen vom definierten „Normaldeutschen“ abweicht, diskriminiert wird, durch alle rechtsstaatlichen Raster fällt, oder für ihn oder sie die Menschenwürde nicht gilt.
Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich ernsthaft Angst, dass Geschichte sich wiederholt. Allerdings bin ich fest davon überzeugt: wir können das noch verhindern. Wenn wir zusammenstehen. Wenn wir laut werden und bleiben. Wenn wir Haltung zeigen und Stellung beziehen.
Ich wünsche mir, ich könnte das „eigentlich“ aus dem Eingangssatz streichen. Arbeiten wir dran. Wählen wir Menschlichkeit.